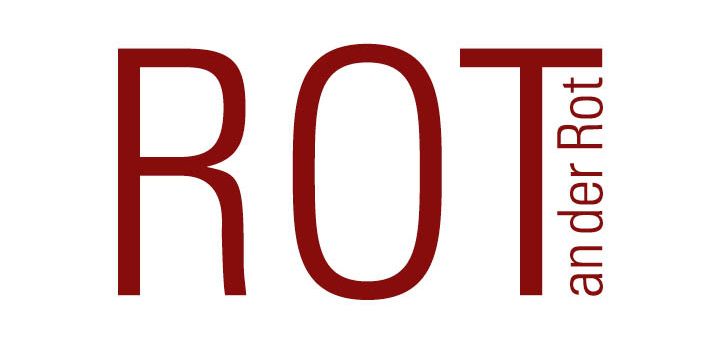Oft fehlgedeutet: das Funkenfeuer

Region – Das Abbrennen von Reisighaufen oder kunstvoll aufgeschichteten sogenannten Funkenfeuern am Sonntag nach Aschermittwoch ist ein sehr alter Brauch. Das Lodern des gewaltigen Feuers nach dem Einbruch der Dunkelheit, verbunden mit dem Verbrennen einer Strohfigur, hat seine eigene Suggestionskraft. Der Brauch ist belegbar von mittelalterlichem Gepräge. Man trifft ihn vor allem in den ehemals katholischen Landschaften des Allgäus an, auch in Vorarlberg, Liechtenstein, dem Tiroler Oberland und dem Vinschgau. Weiter werden in Teilen der Schweiz, der Heuberg-Baar, dem Schwarzwald und Teilen der schwäbischen Alb Funken verbrannt. Auch in den Gebieten des ehemaligen Burgunds wird das Brauchtum ausgeübt, heute also in Ostfrankreich, Südbelgien und dem angrenzenden Rheinland. In Österreich ist der Brauch seit 2010 zu einem nationalen immateriellen Unesco-Kulturerbe erklärt worden. In vielen Orten haben sich eigens Funkenzünfte gegründet, die das Brauchtum am Leben erhalten. Oftmals werden diese auch privat gebaut oder durch Vereine und Verbände wie Kolping und Landjugenden veranstaltet.
Verwandt: das Scheibenschlagen
In engem Zusammenhang steht das Brauchtum des Scheibenschlagens. Dabei werden etwa 15 cm große Holzscheiben – ähnlich einer Diskusscheibe – am Funkenfeuer glühend gemacht und von einem Berghang herunter ins Tal geschleudert. Dazu wird die mittig gelochte Scheibe auf die Spitze eines zwei bis drei Meter langen Haselnusssteckens gesteckt. Die glühende Holzscheibe wird sodann in der Luft geschwungen und schließlich, über eine Holzrampe geschlagen, ins Tal sausen gelassen. Mit gesungenen Sprüchen wird sie bestimmten Menschen gewidmet, vorzugsweise den ledigen Mädchen, aber auch Heiligen oder der „Alten Fasnacht“. Dieses dem Funkenfeuer zugeordnete Brauchelement hat sich an wenigen Orten in Vorarlberg, Graubünden, dem Bündnerland, Tirol oder dem Schwarzwald noch gehalten.
Belege für Aitrach, Watt bei Deuchelried und Sommersried bei Kißlegg
Im württembergischen Allgäu beschreibt Karl Reiser 1894 noch ein heute erloschenes Scheibenschlagen in Aitrach. Sonst deuten nur noch Flurstücke auf dieses bei uns verlorene Brauchtum hin. Beispielsweise trägt in Deuchelried-Watt eine abschüssige Wiese ins Gießbachtal den Flurnamen „Scheibenwiese“ oder eine Hofstelle bei Kißlegg-Sommersried die Ortsbezeichnung „Scheiben“.
Schwellenereignis zwischen Fasnacht und Fastenzeit
Das Funkenverbrennen kann als ein Schwellenereignis zwischen der christlich motivierten Fasnacht und der österlichen Fastenzeit gekennzeichnet werden. Ob es ältere Bezüge gibt, die das Christentum in seinen Festkreislauf inkulturiert hat, ist nicht völlig auszuschließen, bleibt jedoch gänzlich unbelegt. Trotzdem gab und gibt es immer wieder Spekulationen, dass es sich beim Funkenfeuer um eine Reminiszenz an einen vorchristlichen, paganen Frühjahrskult handele. Manche behaupten dies sogar felsenfest. Hier wird dann beispielsweise der Beginn des römischen Neujahrs am 1. März mit dem Funkensonntag in Zusammenhang gebracht. Auch werden immer wieder in den Funkenbrauch germanische oder keltische Bezüge einer Winter- oder Dämonenaustreibung hineinkonstruiert. Letztlich sind alle diese Überlegungen quellenlos, bleiben hochspekulativ und unbelegt. Was man jedoch mit Sicherheit sagen kann ist, dass es sich beim Funkenverbrennen um einen Brauch im Kontext des kirchlichen Jahreskreises handelt.
Hochfragwürdig: der mythologische Ansatz
Im Blick auf die Motive dieser hochfragwürdigen Behauptungen des paganen (heidnischen) Ursprungs von Brauchtümern sehen wir, dass sie ab der Mitte des 19. Jahrhunderts auftauchen. Diese Zeit war geprägt vom Interesse einer nationalen, deutschen Identitätssuche. Der sogenannte mythologische Ansatz war beliebt, wo allerorten germanische Ursprünge behauptet wurden und der Drang bestand, eine vorchristliche, germanische Kausalität herzustellen. Diese sollte dem politisch zersplitterten deutschsprachigen Gebiet eine innere Einheit verleihen. Auch wenn dieser politisch motivierte Ansatz der Romantik in der heutigen europäischen ethnologischen Forschung (Volkskunde) keine nennenswerte wissenschaftliche Bedeutung mehr hat, bleiben die Behauptungen selbst populärwissenschaftlich en vcogue.
Vereinnahmung durch NS-Ideologen
Nicht unerheblich trugen dazu die Nationalsozialisten bei, denen die Erzählungen allen Urgermanischen mehr als gelegen kam. Sie germanisierten das Funkenabbrennen (und genauso die Fasnacht und andere archaisch wirkende Brauchtümer) vollends und deuteten es als paganen Ritus der Winter- und Dämonenaustreibung um. Emotional wirkende Fackelaufmärsche und Gedenkfeuer wurden pseudoreligiös überformt und im Sinne der Nazis instrumentalisiert. Die durch eine Vielzahl an schriftlichen Quellen bestens nachzuweisenden christlichen Wurzeln des Brauches und die Forschungen dazu wurden hingegen bewusst ignoriert und negiert. Die Überwindung von allem Jüdisch-Christlichem war aufgrund der ideologischen Konkurrenz beabsichtigt. Erstaunlicherweise blieben auch nach dem Ende der unseligen Nazizeit diesselben volkskundlichen Ideologen weiter bestimmend. Dadurch hält sich die falsche, nazifizierte Deutung der mythologischen Winteraustreibung bis heute beinahe unausrottbar. Die unbelegten Behauptungen wurden dabei so oft wiederholt, dass sie heute den Rang einer selbstverständlichen Wahrheit bekommen haben. Viele Brauchausübende selbst, Journalisten und neuerdings Touristiker sind überzeugt vom urtümlich germanischen oder wahlweise einem neuerdings hinzukommenden keltisch-druidischen Ursprung des Brauches. Manche Brauchträger selbst übernehmen die so oft wiederholte Umdeutung unhinterfragt, ja befeuern sie sogar populistisch in der Absicht, ihrem Brauchtum noch größere Autorität zu verleihen. Alleine ein Wahrheitsgehalt ist damit nicht verbunden. Die Deutung des Funkenbrauchs bräuchte dringend eine Entmythologisierung und Entnazifizierung!
Fest im mittelalterlich-christlichen Kontext verankert
Wie fest das Funkenfeuer verbunden ist mit einem mittelalterlich-christlichen Kontext, zeigt sich an mehreren Stellen. Auffällig ist, dass der Funkensonntag kalendarisch nicht wie ein Jahrzeitenfest an ein feststehendes Datum gebunden ist, sondern terminlich variiert mit dem Osterfest und seinem 40-tägigen Fastenvorlauf sowie dem nochmals vorgelagerten Brauchkomplex der Fasnacht. Hier liegt der Kontext. An der Schwelle zur Fastenzeit ist das Funkenverbrennen zu finden und stellt schlicht das rituelle Verbrennen der Fasnacht dar.
Die Kardinalfrage: Warum ist das Funkenverbrennen nicht am Fasnachtsdienstag?
Ursprünglich war das Ende der Fasnacht nicht am Fasnachtsdienstag bzw. Aschermittwoch erreicht, sondern tatsächlich am darauf folgenden „Funkensonntag“, dem Sonntag Invocavit. Das alte Ende der Fasnacht wird schon 1090 n. Chr. im Benediktinerkloster Lorsch erstmals mit einem Feuerbrauch nachweisbar. Das Kloster brannte nämlich wegen eines fasnächtlichen Scheibenschlagens am Sonntag Invocavit ab. Die regionale Bischofssynode von Benevent beschloss 1091 n. Chr., dass die Sonntage der Fastenzeit als kleine „Osterfeste“ nicht zu den Fastentagen zu zählen seien. Um quantitativ die 40 Tage bis zum Osterfest halten zu können, rückte man den Beginn der Fastenzeit deshalb vor und damit das Ende der Fasnacht von Sonntag Invocavit auf den heutigen Aschermittwoch. Der Tag des Feuerbrauchs, in Frankreich „dies focorum“ oder „jour des brandons“ genannt, blieb jedoch weiter an seinem alten Termin liegen. Die Brauchausübenden hielten zäh an der alten Gewohnheit fest und widerstanden der Terminreform. So stellt der Funkensonntag bis heute das Ende der „Alten Fasnacht“ oder „Bauernfasnacht“ dar.

Gehören zum Funkensonntag einfach dazu: Funkenringe. Foto: SAV Kißlegg
Funkenringe: Würfeln am Ende des Karnevals
Ebenso gibt es einen weiteren direkten Kontext und Beleg der Zugehörigkeit zur christlich geprägten Fasnacht: die sogenannte „Funkenringe“. Sie sind ein regionales Unikum und kommen am Funkensonntag nur noch im württembergischen und bayerischen Westallgäu vor. Die ringförmig geformten Zopfbrote werden dabei auf den Tisch gelegt und die versammelte Gesellschaft würfelt um deren Besitz, bevor sie dann verspeist werden. Pieter Bruegel d. Ä. hat schon 1559 in seinem Bild „Der Kampf zwischen Karneval und Fasten“ das Würfeln um Fasnachtsgebäck festgehalten. Dabei ist der „Funkenring“ ein klassisches Gebildbrot und spiegelt das fasnächtliche Gehabe mit bretzel- und ringförmigen, eierhaltigen Feinbroten. Solcher Arten von Gebildbroten sind in der schwäbisch-alemannischen Fasnacht allgegenwärtig.
Funkenküchle: Letztes Schmalz vorm großen Fasten
Ebenso verweisen das Auftreten von Schmalzgebäck, also in siedendem Schmalz herausgebackene Teigscheiben, sogenannte „Funkenküchle“ und „übers Knie Zogene“ auf fasnächtliches Brauchtum. So wird der Funkensonntag in Vorarlberg „Küachlisonntag“ oder „Holepfannsonntag“ genannt. In der Zisterzienserinnenabtei Oberschönenfeld (Bayerisch-Schwaben) etwa ist dieses Backen von Funkenküchle an jenem Tag schon im 18. Jahrhundert dokumentiert und wird bis heute ausgeübt. In der Nordschweiz oder in Landeck (A) gilt der heute als 1. Fastensonntag gezählte Sonntag als „Kassunnti“ (Käsesonntag) und bezieht sich auf in Fett herausgebackenen Käse im Teigmantel. Dies deutet ebenfalls auf die einst nahende Fastenzeit. Eier und Schmalz wie auch Käse sind neben dem Fleisch tierische Lebensmittel, die in der Fastenzeit – dem strengen Fast- und Abstinenzgeboten geschuldet – nicht verspeist werden durften. Sie wurden eben darum noch rechtzeitig und lebensfroh „vernichtet“. Karnevale – „Fleisch ade“!
Die Funkenhexe: Symbol des Abschieds von der Fasnet (Fasnacht)
Um es gleich voraus zu sagen: Die Figur, die auf dem Funkenfeuer verbrannt wird, hat in keiner Weise etwas mit den schrecklichen Feuern der unseligen Hexenverfolgungen zu tun. Sie ist auch nicht der personifizierte Winter, wie in den mythologischen Spekulationen falsch behauptet wird. Vielmehr handelt es sich im oben beschriebenen Kontext betrachtet bei der Figurenverbrennung um das symbolische Verabschieden von der Fasnacht. Ab dem Ende des 15. Jahrhundert wurde das zeichenhafte Verbrennen einer Strohpuppe üblich, welche die personifizierte Fasnacht – den Narr – darstellen sollte. Der Narr ist, biblisch begründet, im Mittelalter der gottabgewandte und -vergessene Mensch bzw. die Fasnacht galt als gottabgewandte Zeit. Diese Zeit ist nun zu Ende. Der Mensch soll sich nun wieder ganz Gott hinwenden. Die närrische, schlemmende, verruchte, gottferne Figur der Fasnacht wird, um es anschaulich zu machen, symbolisch in der Funkenfigur verbrannt. Sie ist geradezu der theatralisch gespielte, wenn auch makabre innere Sinn des Feuers. Dass daraus in vielen Fällen eine Hexe geworden ist, ist eine Brauchentwicklung, die man im ursprünglichen Deutungshorizont als Verbrennung des Widergöttlichen durchaus nachvollziehen kann. Wo diese Deutung jedoch nicht mehr vorhanden ist, kann die brennende Hexe durchaus missverständlich sein und eine falsche Interpretation als Frauenverbrennung erfahren.
Autor vorstehenden Aufsatzes ist Stephan Wiltsche, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege im Württembergischen Allgäu e.V. und ehrenamtlicher Ortsheimatpfleger der Stadt Wangen. Im Hauptberuf arbeitet der 53-Jährige als Dekanatsreferent und Klinikseelsorger.