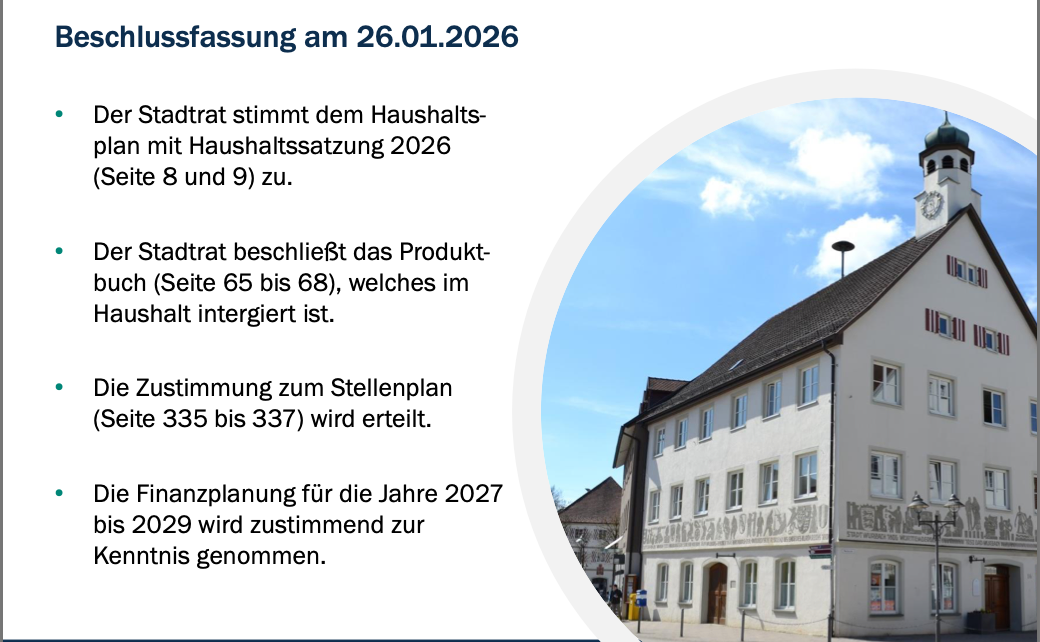Josef Schöllhorn – ein Bauernleben

Hauerz – Es ist das Gebiet, wo Feldkreuze am Wegesrand von gottesfürchtigen Leuten erzählen und zum „Gelobt sei Jesus Christus” einladen. Saftstrotzende Täler, grüne Hügel, Äcker, Ställe und Fahrsilos. Milchland Oberschwaben, genauer Hauerz, ein Dorf am Rand des Allgäus, wo die Telefonnummern noch dreistellig sind und der Kirchenchor bei Beerdigungen das Haurzer Lied anstimmt: „Wo meiner Kindheit Wiege stand und mich bewahrt die Mutterhand, nur dort leb ich in Glück und Ruh, O Hauerz mein, wie schön bist du!”
Genau in dieser Idylle hat Josef Schöllhorn seine 90 Lebensjahre verbracht, als Bauernkind und später mit einem eigenen Hof. Die Gäste am Stammtisch beim Unteren Wirt reden vom „Noagea” – wer alles bald aufhört. Wer schon lange „koi Milch mea liafret”. Wer „an nuia Stall baua sott, weil d Anbindehaltung verbotte wird.” Und mit einem Melkroboter hängt der Bauer alleweil am Handy und hat auch „koi Ruah”. Man muss sehen, wie man überlebt als Bauer. „Die Kleinen werden immer weniger und die Großen immer größer.“
Josef Schöllhorn hat Bauernfamilien wachsen sehen. Miterlebt, wie eines Tages der neugeborene Junior in der Wiege lag, wie der Junior selber einen Junior bekam. Er hat gesehen, wie Betriebe langsam verkommen sind. Er hat die Alten gehen sehen. Viel hat sich geändert. Früher hatte die Molkerei in seinem Dorf einen Lastwagen, der die Milchkannen geholt hat. Heute kommt ein Tankwagen eines Fuhrunternehmens und fährt tausende von Litern nach Ulm, Ravensburg oder noch weiter. Ein Glück, dass man noch den Sepp, den Fahrer kennt.
Früher waren die Leute in den Dörfern enger beisammen, durch die vielen Zuzügler und Baugebiete sind sie immer weiter auseinandergerückt. Maisfelder dominieren die Flächen – für die Biogasanlagen. „Früher war das Milchhäusle mit dem Bock für die Kannen ein Treffpunkt, man hat geschwätzt, Neuigkeiten ausgetauscht. Oft haben drei, vier Generationen in einem Haus gelebt. Das geht jetzt nicht mehr. Meist baut der Bauer ein Betriebsleiterhaus auf dem Grundstück oder ein Ausgedinghaus ganz woanders im Ort.
Gerade jetzt muss überlegt sein, ob man sich vergrößert und nochmal eine Million reinsteckt, sagt ein Bauer. „Du muascht immer reistecke, wenn da a reachte Sach übergea witt!” Als Landwirt ist man frei, das stimmt schon, hört man sagen. Man hat sein Land, könnte Ackercross veranstalten, ohne irgendjemand zu stören. „Man ist sein eigener Herr, aber auch sein eigener Sklave. Oft isch´s a so, dass i vor lauter Arbet nimma nausseh.” Eine oft gehörte Klage.
Frühling, das sei immer die schöne Zeit gewesen. Winter die schlechte: Eis, Schnee. „Aber das härtet ab, ich bin nie krank gewesen“, sagt Josef Schöllhorn. Es war das Jahr 1942, als er eingeschult wurde und die zwei Kilometer ins Dorf bei jedem Wetter zu bewältigen hatte. Ab seinem dritten Schuljahr hat er abends drei Kühe von Hand melken müssen. Seine drei Schwestern waren ebenfalls eingespannt.
Erst im Jahr 1955 kam ein Traktor auf den Hof, der erste mit 18 PS erwies sich als zu schwach für die vielen Buckel. Die vier Zugochsen davor hatten kein Problem mit den vollbeladenen Wagen, nur für das Mähwerk und den Bindemäher waren sie zu langsam. Daher hatten drei Stuten noch ihre Arbeit und ihren verdienten Hafer. Die erste Melkmaschine tat den Eutern nicht gut, also weiterhin Handarbeit der drei Schwestern. Stallarbeit war nicht nur das Melken, auch das Misten, Einstreuen war Handarbeit. Torfmull aus dem Wurzacher Ried war gut für trockene Liegeplätze und es gab eine gute Gülle, erinnert sich Josef Schöllhorn. Erst als zwei Brüder aus der Gefangenschaft entlassen waren, hatte der Schulerbub Josef Arbeitserleichterung und mehr Zeit für die Schule. Das „Morgengebet“ weiß er noch: „Guten Morgen, Herr Lehrer, wir Buben und Mädchen von Dörfern und Städtchen, wir rufen laut dir zu Heil Hitler!“
Die Kirche war immer voll. Pfarrer Hund war ein Bauernsohn; wenn es nötig war, verkündete er zur Erntezeit von der Kanzel: „Am heutigen Sonntag ist Arbeit erlaubt!“ Daheim gab es vor dem Essen ein Gebet und nachher das Vaterunser. „Darauf hat meine Mutter bestanden, weil vier Söhne Soldat waren.“ Als der Vater am 4. März 1945 starb, gab es für die Soldatensöhne Sonderurlaub. Einer durfte bis 16. April bleiben. Die Mutter wollte ihn gar nicht gehen lassen in dieser nahen Zeit des Zusammenbruchs. Doch der Junge hatte so viel Respekt vor den Feldjägern: „Mutter, die kommen sonst und erschießen mich auf dem Hof!“ Er ging wieder, bis Wien, und galt als vermisst, bis im Jahr 1964 der Tod vom Suchdienst bestätigt wurde.
Im Jahr 1962 ging Josef Schöllhorn – da war er 27 – auf ein Höfle im Dorf, wo er mit seiner Frau Regina bis ins Rentenalter das „Sach“ umgetrieben hat. Jetzt, wo das Leben beschwerlicher wird, darf er seinen Lebensabend auf seiner Hoimet verbringen. Genau dort, wo seiner Kindheit Wiege stand und ihn bewahrte die Mutterhand. Dort lebt er in Glück und Ruh: Im Ohr hat der treue Kirchenchorsänger bestimmt das Lied: „Oh Hauerz, mein, wie schön bist du!“

Josef Schöllhorn, 90 Jahre. Nach einem arbeitssamen Leben verbringt er nun seinen Ruhestand auf der „Hoimet“, auf jenem Hof, von dem er stammt. Foto: Hans Reichert
Text: Hans Reichert